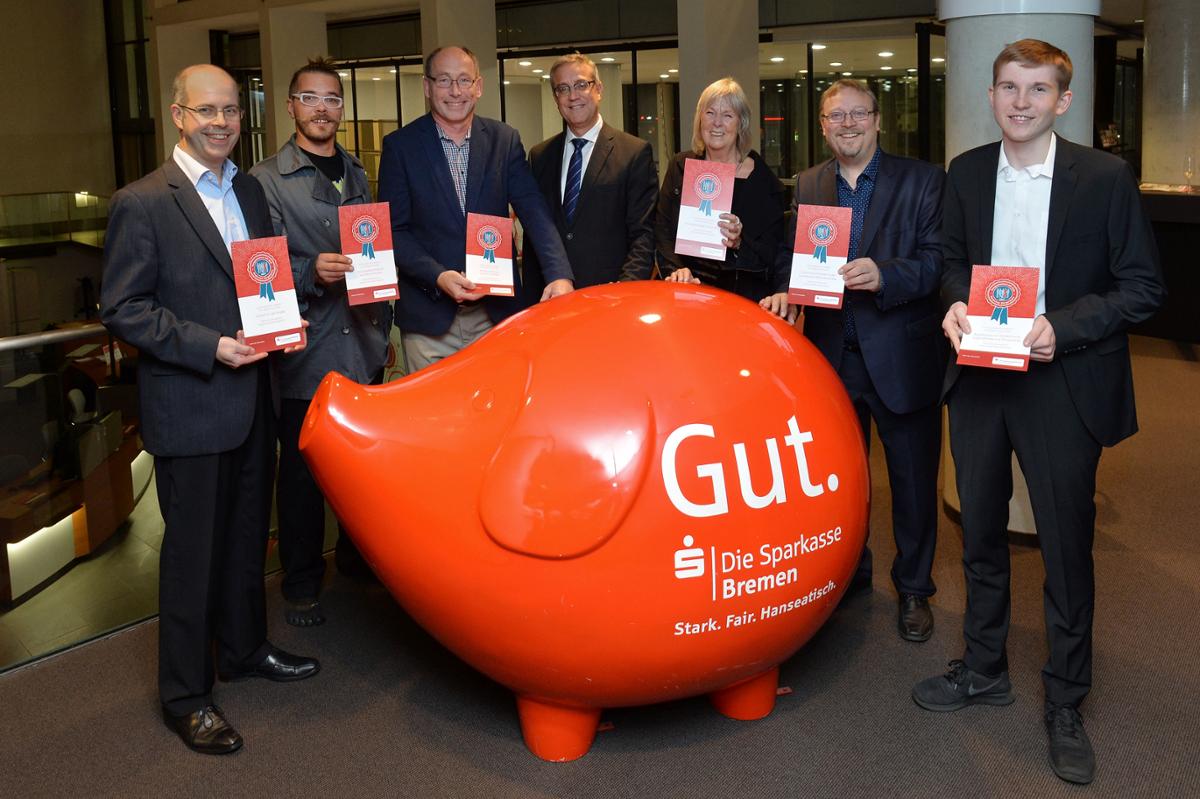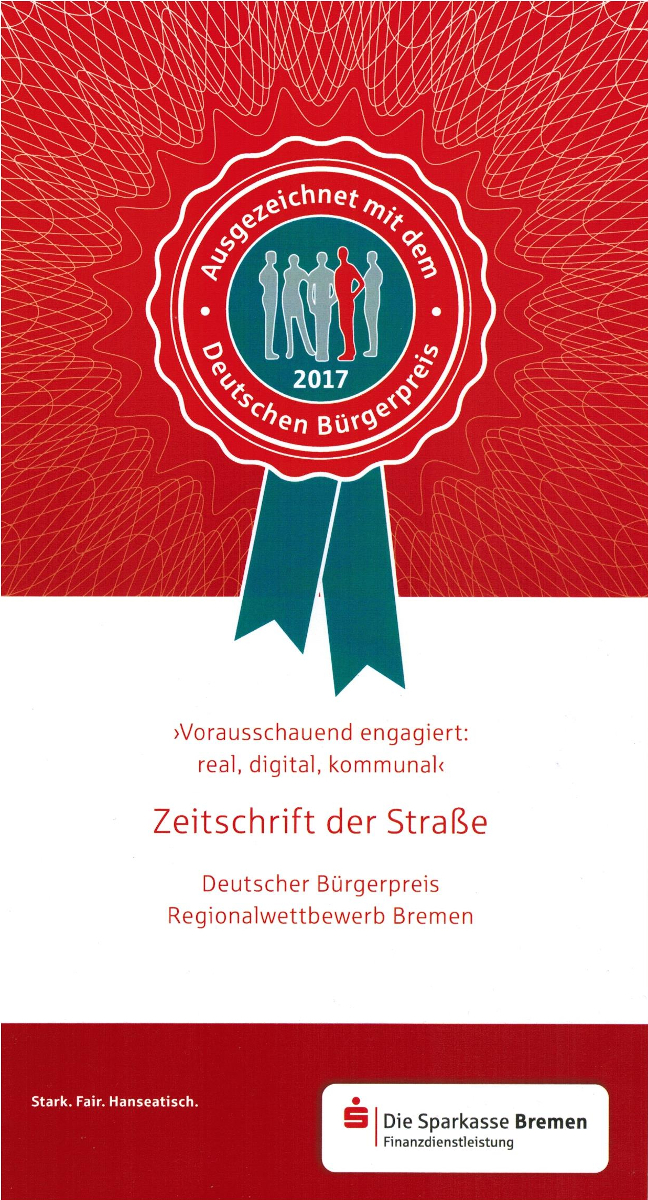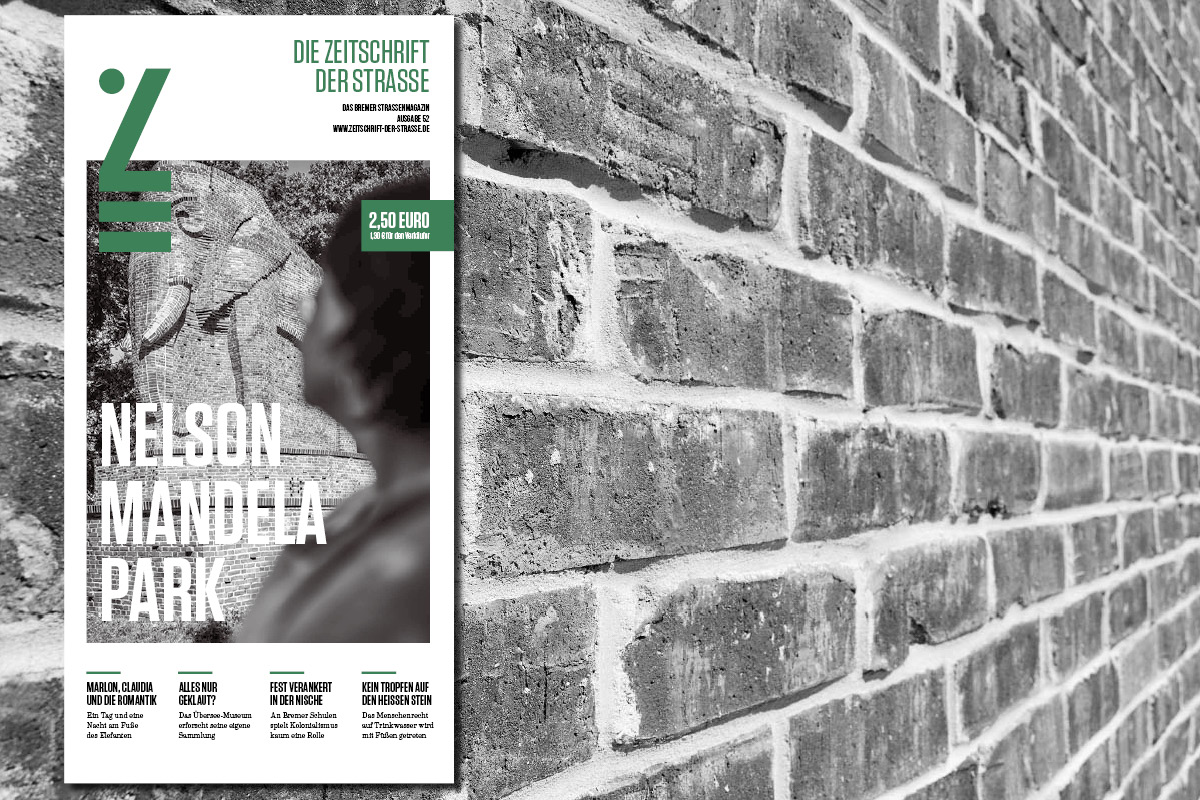#53 DOM: Früher war Horst Isola Landesvorsitzender der SPD, heute kämpft er für die Trennung von Staat und Kirche. Ein Gespräch über Lobbyismus, Auschwitz, die Sozialdemokratie und 20 Schläge
Haben Sie eine Mission, Herr Isola?
Mission wäre zu hoch gegriffen, aber ich habe politische Auffassungen und Grundsätze. Eine davon ist die Trennung von Kirche und Staat.
Geht es Ihnen nur ums Prinzip, oder was ist das Problem?
Religion ist Privatsache! Jede:r kann glauben, was er oder sie will. Das ist geschützt durch das Grundgesetz. Für mich ist es aber ein Prinzip der Demokratie, dass sich die Kirchen aus der Politik heraushalten. Wer sich auf ein nicht kontrollierbares höheres Wesen beruft, unterläuft die Demokratie. Was mich weiter stört, ist die Privilegierung der Kirchen mit Steuergeldern in Milliardenhöhe.
Was Sie also stört, ist die Bevorzugung der Kirche und nicht ihre Inhalte.
Ich bin Atheist. Was soll ich da zu den Inhalten der Kirche und deren Religion sagen, die gehen mich nichts an. Das Problem ist die fehlende Trennung zwischen Religion und Politik. Es gibt eine Reihe von Staaten, die den Laizismus verfassungsrechtlich festgeschrieben haben, etwa Frankreich. Nehmen wir das Thema Schule: mit Ausnahme von Bremen, Hamburg und Berlin ist in den Bundesländern der Religionsunterricht verpflichtend. Wer seine Kinder religiös erziehen will, kann das ja tun. Aber an öffentlichen Schulen hat Religion nichts zu suchen.
Aber kann man diesen Unterricht nicht so begreifen, dass man etwas über Religionen lernt?
Das ist auch unsere Forderung. Junge Menschen sollten wissen, was für Inhalte die Religionen haben, was sie tun und vor allem, was sie seit ihrem Bestehen angerichtet haben. Aber bitte keinen Verkündungsunterricht mit dem Ziel der Missionierung.
Aber in Deutschland hat man es doch geschafft, die politische Macht der Kirche zurückzudrängen.
Leider nicht. Trotz dramatisch rückläufiger Mitgliederzahlen ist der Einfluss der Kirchen in den letzten Jahren sogar gewachsen, sodass Kritiker:innen von einer Kirchenrepublik Deutschland sprechen. Warum? Die Kirchen tun so, als seien sie unverzichtbar im gesellschaftlichen und politischen Leben. Und sie haben überall ihre Lobbybüros, im Bund und in den Ländern, gefördert und unterstützt vom Staat und von fast allen Parteien.
Andere etwa nicht?
Natürlich machen auch die Gewerkschaften Interessenpolitik, aber sie sind keine Körperschaften des öffentlichen Rechts wie die Kirchen und erhalten auch keine finanziellen Zuwendungen in Milliardenhöhe vom Staat. Dagegen werden die Kirchen sogar beim Arbeitsrecht privilegiert: für ihre Mitarbeiter:innen gibt es beispielsweise kein Streikrecht und häufig nicht einmal Tarifverträge. Was ich noch viel schlimmer finde, ist das individuelle Arbeitsrecht. Die Kirchen dürfen ihre Mitarbeiter:innen diskriminieren, und das ist ihnen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sogar noch erlaubt! Wenn etwa ein Arzt / eine Ärztin einer katholischen Klinik sich scheiden lässt und wieder heiratet, kann ihm / ihr gekündigt werden. Aber auch wenn er / sie eine homosexuelle Partnerschaft öffentlich macht oder sich positiv über Homosexualität, künstlicher Befruchtung oder Abtreibung äußert. Eine Diskriminierung, gebilligt und gewollt von unseren demokratischen Parteien!
Die vom Grundgesetz gedeckt ist.
Richtig, und die Rechtsprechung deckt diesen unglaublichen Zustand … Bis jetzt hat sich das Bundesverfassungsgericht immer auf die Seite der Kirchen geschlagen. Man muss sich das einmal vorstellen: da fliegen Reinigungskräfte bei kirchlichen Einrichtungen raus, wenn sie aus der Kirche austreten. Als ob es katholisches Operieren oder evangelisches Putzen gäbe! Allerdings zeichnet sich in den letzten Jahren bei einigen Gerichten ein Umdenken ab. In der Weimarer Verfassung steht, die Kirchen haben ein Selbstverwaltungsrecht. Die Kirchen sagen dagegen: Wir haben ein Selbstbestimmungsrecht und werden in dieser Auffassung vom Bundesverfassungsgericht unterstützt – gegen den Wortlaut des Grundgesetzes.
Was ist der Unterschied?
Nehmen wir den ADAC: Dieser Verein hat natürlich ein Selbstverwaltungsrecht, er kann also entscheiden, wie seine interne Verwaltungsabläufe zu regeln sind. Aber er hat kein Selbstbestimmungsrecht: Der ADAC kann also nicht sagen, dass für seine Mitglieder die Straßenverkehrsordnung nicht gilt. Für die Kirchen aber wurde das für alle anderen geltende Arbeitsrecht außer Kraft gesetzt. Das halten wir Laizisten für einen Skandal. Aber ich sehe gegenwärtig kaum eine Chance, das zu ändern.

Was wird aus den kirchlichen Kindergärten in Bremen, wenn die Kirchen ihre Privilegien verlieren?
Dann müssen sie zu den gleichen Bedingungen arbeiten wie beispielsweise die Arbeiter:innenwohlfahrt.
Die gerade in Bremen besonders SPD-nah ist.
Es gibt ja auch noch die staatlichen Kindertagesstätten.
In letzter Zeit war die staatliche Kita-Organisation in Bremen eher überfordert.
Na ja, jammern nach mehr Geld tun die Kirchen auch. Ich sage ja nicht, dass die Kirchen völlig raus sollen aus dem Geschäft. Aber es ärgert mich, dass sie sich öffentlich hinstellen und sagen, wir tun nur Gutes, während der Sozialstaat zu mehr als 90 Prozent für die Unkosten aufkommt. Im übrigen sind Kindergärten ein schönes Missionierungsfeld für die Kirchen.
Die Bremer Verfassung ist bei der Trennung von Staat und Kirche ja sehr fortschrittlich. Woran scheitert es in der Praxis?
„Die Kirchen und Religionsgesellschaften sind vom Staate getrennt“, steht in Artikel 59 der Landesverfassung. Entgegen diesem eindeutigen Wortlaut haben wir in Bremen kurioserweise einen Kirchensenator.
Der gleichzeitig Bürgermeister ist.
Ja, das gibt es in keinem anderen Bundesland, nicht mal in Bayern. Wir haben doch auch keine:n Werdersenator:in.
Was liegt ihrer Partei, der seit 1945 regierenden SPD, an so viel Kirchennähe?
Die Bremer SPD ist in der Tat besonders kirchenfreundlich. Kirchenmitglieder sind Wähler:innen, ein großer Teil der SPD-Mitglieder ist in der Kirche aktiv. Dagegen ist im Prinzip auch nichts einzuwenden, obwohl es den Absturz der SPD in der Wähler:innengunst auch nicht verhindert hat. Aber muss es sein, dass mittlerweile fünf Religionsvertreter:innen im Rundfunkrat sitzen? Immerhin hat neuerdings auch ein Vertreter des humanistischen Verbandes einen Sitz dort.
Der wiederum ist die einzig nennenswerte Lobby der Nicht-Gläubigen. Aber haben diese Menschen überhaupt ein gemeinsames Interesse?
Das Problem ist, dass Nichtkonfessionelle überwiegend desinteressiert sind, sich einzubringen und zu organisieren. Es gibt keine Bereitschaft, sich zu binden.
Woran liegt das?
Für die Bürger:innen ist die Frage von Politik und Kirche allenfalls sporadisch ein Thema. Andere Themen gehen vor: Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Bildung und so weiter.
Man hat das Gefühl, dass die Laizist:innen in der SPD nur geduldet sind, weil Sie eine prominente Figur in der Partei sind.
Nach dem Motto: Lass ihm doch die Spielwiese? Vielleicht. Leider begegnen wir in der Partei, vor allem im Landesvorstand, erheblichen Vorbehalten bis zur schroffen Ablehnung.
Ist die wachsende Religiosität nicht Folge einer Verzweiflung an der Komplexität der globalisierten Welt?
Das würde sie erklären. Aber damit wird es ja nicht richtiger. Die Stärke der Leute, die immer mehr darauf drängen, dass Religion in die Politik kommt , um damit von den eigentlichen Problemen und deren Ursachen abzulenken, ist gleichzeitig die Schwäche von Leuten, die für mehr Aufklärung stehen. Aufklärung ist ja heute schon fast ein Schimpfwort.
Die Menschen verbinden vielleicht damit nicht Werte wie Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit, die die Kirche für sich reklamiert.
Dieser Trick läuft seit 2000 Jahren. Ich finde es anmaßend zu behaupten, dass nicht-religiöse Menschen keine Empathie haben.
Die Kirchen würden das auch nicht bezweifeln.
Das mag in Ausnahmefällen so sein. In der Regel aber reklamieren die Kirchen für sich die Monopolstellung in Sachen Nächsten- und Friedensliebe. Die Realität sieht oftmals anders aus, wenn man beispielsweise die empörende Rolle der katholischen Kirche im früheren faschistischen Franco-Spanien oder – aktuell – in Kolumbien betrachtet, wo sich hohe Kirchenvertreter nicht genieren, öffentlich zum Mord an Liberalen und Linken aufzurufen.
Angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen: Erledigt sich der Einfluss der Kirche nicht auf die Dauer von allein?
Da können wir noch lange warten! Wir erleben gegenwärtig das Paradoxon, dass trotz dramatisch abnehmender Mitgliederzahlen die Religionsgemeinschaften noch mehr an politischen Einfluss gewinnen.
Wenn die Kirchen sich zurückzögen, wäre das Feld frei für Wirtschaftsverbände, zu denen die Kirchen ein Gegengewicht bilden. Wenn die Kirche keinen Lobbyismus mehr macht, haben andere noch mehr Raum, sich auszubreiten.
Das sehe ich nicht so. Es sind die Gewerkschaften, die ein politisches Gegengewicht zu den Wirtschaftsverbänden bilden und nicht die Kirchen.
Woher kommt Ihr laizistisches Engagement überhaupt?
Ich fand Religionsgeschichte schon immer spannend. Ich habe mich schon als Schüler viel mit der Bibel beschäftigt, vor allem mit dem Alten Testament. Ich war verblüfft, wie ein sogenanntes Heiliges Buch nur so von Geschichten über Mord und Totschlag wimmeln kann. In der vierten Klasse habe ich mal gesagt: Es gibt keinen lieben Gott. Dafür bekam ich 20 Schläge mit dem Lineal. Zu Hause sagte mein Vater dann: Das hast du richtig gemacht. Ich stamme aus einem katholischen Haushalt, aber meine Eltern waren schon aus der Kirche ausgetreten. 2010 habe ich dann den Gesprächskreis Laizist:innen in der SPD mitbegründet.
In einem Interview haben Sie mal gesagt: Wie kann man nach Auschwitz noch an einen gerechten und gütigen Gott glauben. Sind Sie deshalb Atheist?
Ich kann nicht religiös sein, dagegen spricht mein gesunder Menschenverstand. Kant hat gesagt „Sapere aude“ – Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! Diesen Wahlspruch der Aufklärung habe ich mir zeitlebens zur Lebensmaxime gemacht. Hinzu kommt, dass die Geschichte des Christentums eine einzige Kriminalgeschichte ist, in der die Religionen und deren Vertreter sich immer wieder als Brandstifter und Brandbeschleuniger betätigt haben. Und wenn ich an die tausendfachen Sexualverbrechen von Priestern in der jüngsten Zeit, begangen an Kindern, denke, das Sterben von Millionen von Kindern in Afrika und Asien, das Elend der Flüchtlinge, da frage ich mich, wie man da noch an einen allwissenden, allmächtigen und vor allem barmherzigen Gott glauben kann.
Horst Isola, 78, war in den siebziger Jahren Leiter einer Jugendstrafanstalt, später Senatsrat in Bremen und für die SPD von 1987 bis 2003 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. 1991/92 war er zudem Landesvorsitzender der Partei. Seit 2010 ist als Sprecher für die Gruppe der Laizist:innen in der SPD aktiv.
| Interview: Philipp Jarke, Jan Zier | Fotos: Jan Zier |