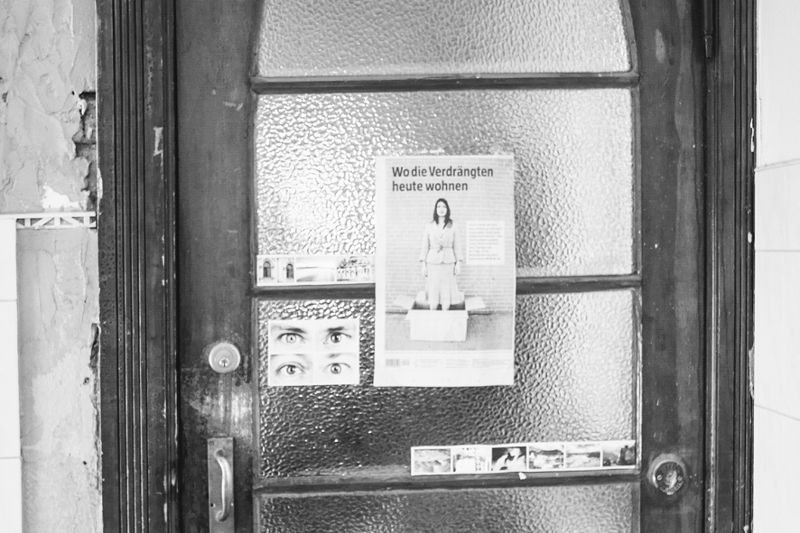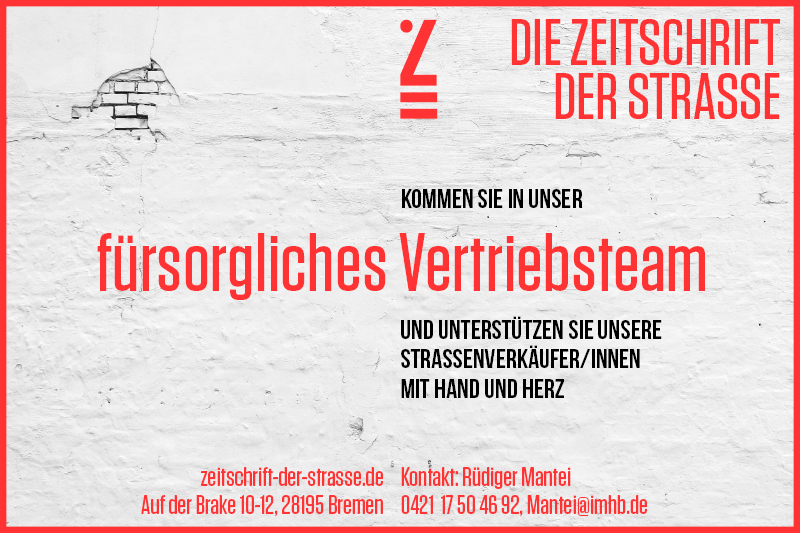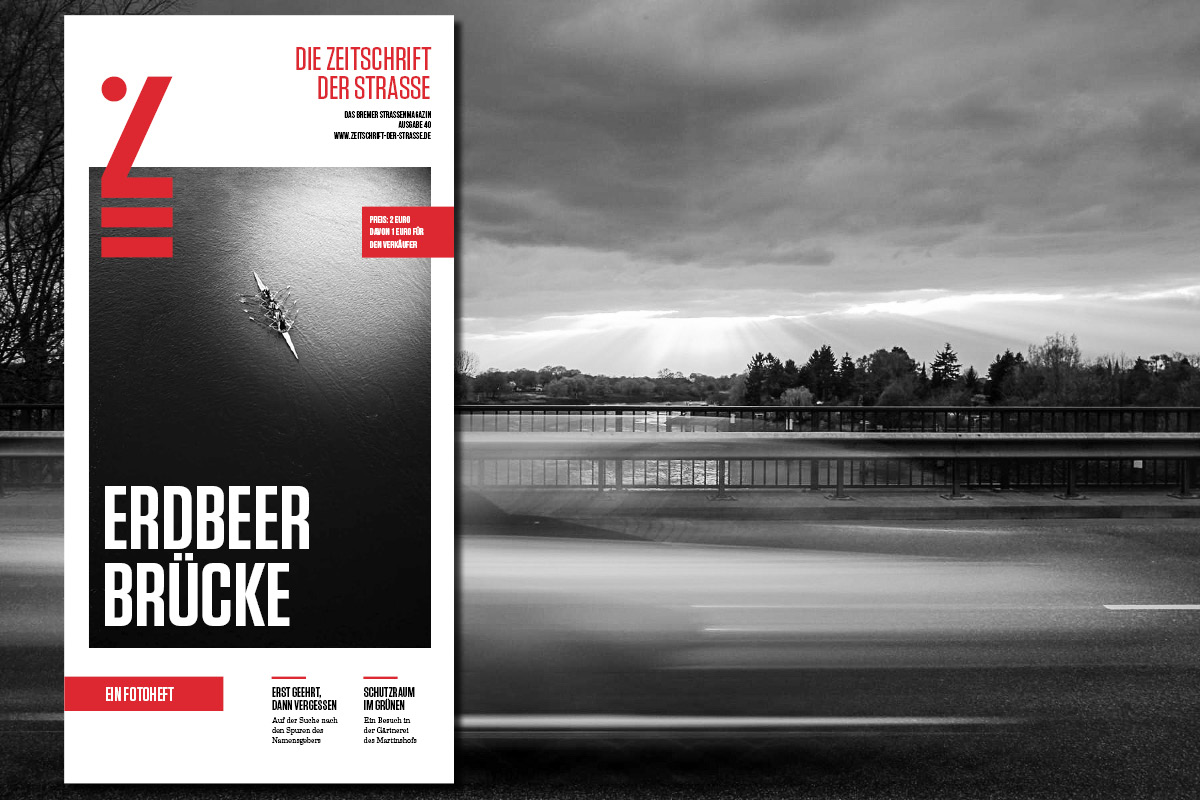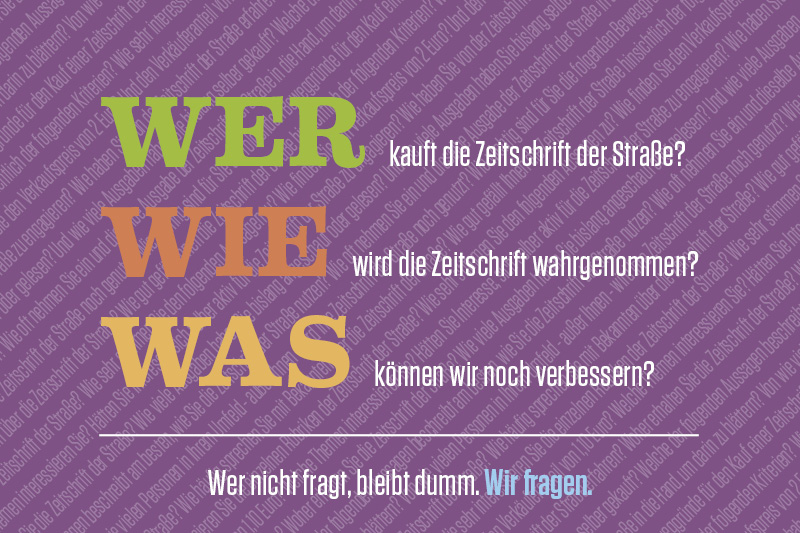#42 WOLLKÄMMEREI – Was soll eigentlich aus der Wollkämmerei werden? Wir haben ein paar Leute gefragt, die sich mit so was auskennen
Das ganze Gelände ist größer als der Vatikan. Aber eine Brache, mehr oder weniger. Und das schon seit vielen Jahren: 2009 machte die Bremer Wollkämmerei endgültig dicht. Was geblieben ist? Eine „Perle der Industriekultur“, wie die Bremer Wirtschaftsförderer schreiben, und zwar eine mit „hohem Entwicklungspotenzial“. Aber was genau soll das heißen?
Anfrage bei Klaus Hübotter: Der Alt-Kommunist und Ehrenbürger hat als Kaufmann und Bauherr schon zahllose historische Gebäude in Bremen gerettet. Den Schlachthof und den Speicher XI, das Bamberger Haus, die Villa Ichon, den alten Sendesaal von Radio Bremen. Und so weiter! Wenn also irgendjemand eine gute Idee für die Wollkämmerei haben könnte, dann ist es Klaus Hübotter. Doch er sei „ohne Zeit und Ideen“, schreibt uns der Mittachtziger, mit besten Grüßen.
Vom Ghetto zur zentralen Vision
Mit seiner Architektur der Gründerzeit sei das Gelände „ideal als Bürofläche für Künstler, Designer, Ingenieure und Architekten, für Gastronomie oder als Veranstaltungsraum“, behaupten die Wirtschaftsförderer. „Das ist genau die Fantasielosigkeit, die Bremen kaputt macht“, sagt Arie Hartog, der Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses, ein Mann, der sich gerne grundsätzliche Gedanken über die Stadt macht. „Wir denken solche Gebiete ja immer als Peripherie und Ghettos“, sagt Hartog – daher auch die Idee, Künstler dort anzusiedeln. „Es sind Reste. Also müssen wir die Denke umdrehen und behaupten: Das wird das Zentrum und es dann städtebaulich entwickeln.“ Diejenigen, die sich da dranmachen, sagt Hartog noch, die sollten mal Lucius Burckhardt und Doug Saunders lesen, „um den Kopf von stadtplanerischen Dogmen zu lösen“.
Der erste Versuch einer Vision für die Wollkämmerei
Noch sprechen die zuständigen Wirtschaftsförderer allerdings lieber von einem „Branchenmix aus Metall-, Maschinen- und Anlagenbau, Spedition, Chemiefaserproduktion und Heizkraftwerk.“ 2011 hat Bremen das Gelände für drei Millionen Euro gekauft, ein Jahr später wurde das Ensemble unter Denkmalschutz gestellt. Und der „Palast der Produktion“ zog ein. Es war dies der erste Versuch, so etwas wie eine Vision für die Wollkämmerei zu entwickeln: Vier Wochen lang durften 90 Kreative nach einem „Gegenmodell zur vereinzelten Erwerbsarbeit“ suchen. Möglich gemacht haben das damals die beiden Architekten Daniel Schnier und Oliver Hasemann von der „ZwischenZeitZentrale“ (ZZZ). In der ganzen Stadt denken die beiden sich Konzepte und Zwischennutzungen für leer stehende Häuser und Brachen aus, mittlerweile im offiziellen Regierungsauftrag.
Kreative Konzepte für die Wollkämmerei mit Brauerei und Kleingewerbe
Hasemanns Idee: In die ehemalige „Sortiererei“ der Wollkämmerei, 4.500 Quadratmeter groß, könnte „Schafs-Bräu“ einziehen, eine „Brauerei-Manufaktur“ für das, was man heute Craft Beer nennt. Zugegeben, auch Daniel Schnier hat diese Idee anfangs belächelt – andererseits: In der Union Brauerei in Walle funktioniert sie gut. Daneben würde Schnier gerne „Kleinstgewerbe“ ansiedeln, „mit Leuten, die mit ihren verrückten Ideen sonst keine Chance haben“. Die aber, beispielsweise, Lebensmittel produzieren wollen, regionale Produkte. Ein, zwei Jahre könnten Teile der Wollkämmerei oder einige der leer stehenden Läden drumherum mietfrei abgegeben werden, an Leute, die weder Raum noch Kapital haben und eigenverantwortlich arbeiten wollen.
Raum für Feiern und kreative Nutzungsmöglichkeiten
Auf den großen Investor zu warten lohnt jedenfalls nicht, sagt Schnier – und wenn, dann würde der wohl eh in die Überseestadt gelotst. „Und bevor die nicht voll ist, passiert auch in der Wollkämmerei nichts.“ Und was noch fehlt, in Bremen-Nord, das sind Räume für Feierlichkeiten, zum Beispiel, wenn man zehn Kids einlädt – oder auch viele Hundert Verwandte und Freunde, wie es auf Hochzeiten öfter vorkommt, gerade bei muslimischen. Und wer so etwas sucht, in Bremen, wird oft erst in Hannover fündig, sagt Schnier. Stattdessen treffen sich nun am Wochenende die Auto-Tuner auf dem Gelände, und manchmal gibt es auf der historischen Achse sogar kleine Rennen. Das passt dann irgendwie doch wieder ganz gut, wo doch oft vom „Detroit Bremens“ die Rede ist, wenn es um Blumenthal und die Wollkämmerei geht.
Über die Entwicklung von Industriebrachen und die Zukunft der Wollkämmerei
Verena Andreas ist eine, die viele solcher Industriebrachen kennt: „In Dortmund spazierte ich um den Phoenix-See – dort wo früher ein Stahlwerk stand. In Duisburg kletterte ich auf einen Hochofen, in Manchester ging ich zwischen alten Fabrikhallen entlang, in denen nun an Laptops gearbeitet wird, besuchte Plattenläden und Bars in einer alten Baumwollbörse. In Detroit freute ich mich über Bagelshops und Burgerläden, Urban Gardening und Kunstprojekte, die mir kurzzeitig Zuflucht vor den verfallenden Straßenzügen boten. Und wer heute in Barcelona an der Strandpromenade das Mittelmeer genießt, erahnt wohl kaum noch, dass dort vor 30 Jahren große rauchende Industrieanlagen die Stadt vom Meer abschnitten.“ Andreas ist Raumplanerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen. Dort beschäftigt sie sich mit Stadtplanung und -entwicklung; auf Reisen spaziert sie gern durch brachliegende Viertel in alten Industriestädten. Auch die Wollkämmerei kennt sie gut: Verena Andreas ist Mitautorin einer neuen Studie über die Entwicklung in Bremen-Nord.
Potenziale und die Notwendigkeit ganzheitlicher Stadtentwicklung
„Das Gelände hat besondere Qualitäten: die Weser und die nahe gelegenen Parkflächen sowie die besonderen Gebäude der historischen Achse“, sagt die Raumplanerin. „Warum wurden diese Qualitäten nicht für das allseits beliebte Wohnen am Wasser oder für kleine Startups und Dienstleistungsunternehmen erschlossen, so wie andere Städte dies mit vergleichbaren Flächen machen?“ Weil das Gelände ein Gewerbegebiet ist, das ganz viele Arbeitsplätze schaffen soll. „Aber es kann nur dann zu einem lebendigen und wirtschaftsstarken Arbeitsort und Entwicklungsmotor in der Stadt werden, wenn der Rest Blumenthals mit seinen gravierenden Problemlagen parallel entwickelt wird“, sagt Andreas: „Es braucht große Investitionen – öffentliche wie private.“ Damit ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich Menschen wohlfühlen – als Arbeitnehmer und Bewohner. Ein Umfeld, in dem die Leute in der Mittagspause etwas essen gehen können, in dem sie attraktiven und bezahlbaren Wohnraum finden, dazu Kinderbetreuungsplätze und Schulen, auf die man seine Kinder gerne schickt.
„Dafür braucht es Eingriffe an der gesamten Achse zwischen Wätjens Park und Bahrsplate und später auch darüber hinaus.“ Es geht nicht allein um die Wollkämmerei, sagt die Wissenschaftlerin. Sondern darum, „das ganze Stadtteilumfeld von Arbeiten über Wohnen bis hin zur Bildung als Ganzes zu betrachten und zu entwickeln“.
| Text: Jan Zier | Foto: Wolfgang Everding |