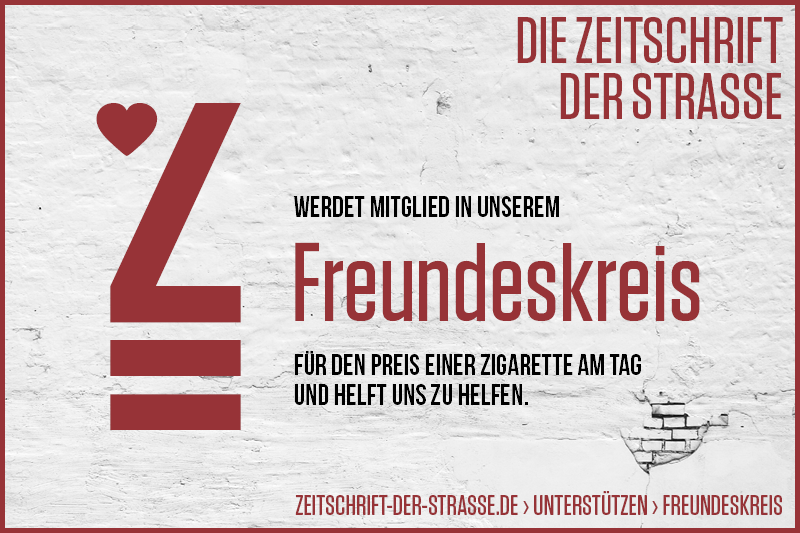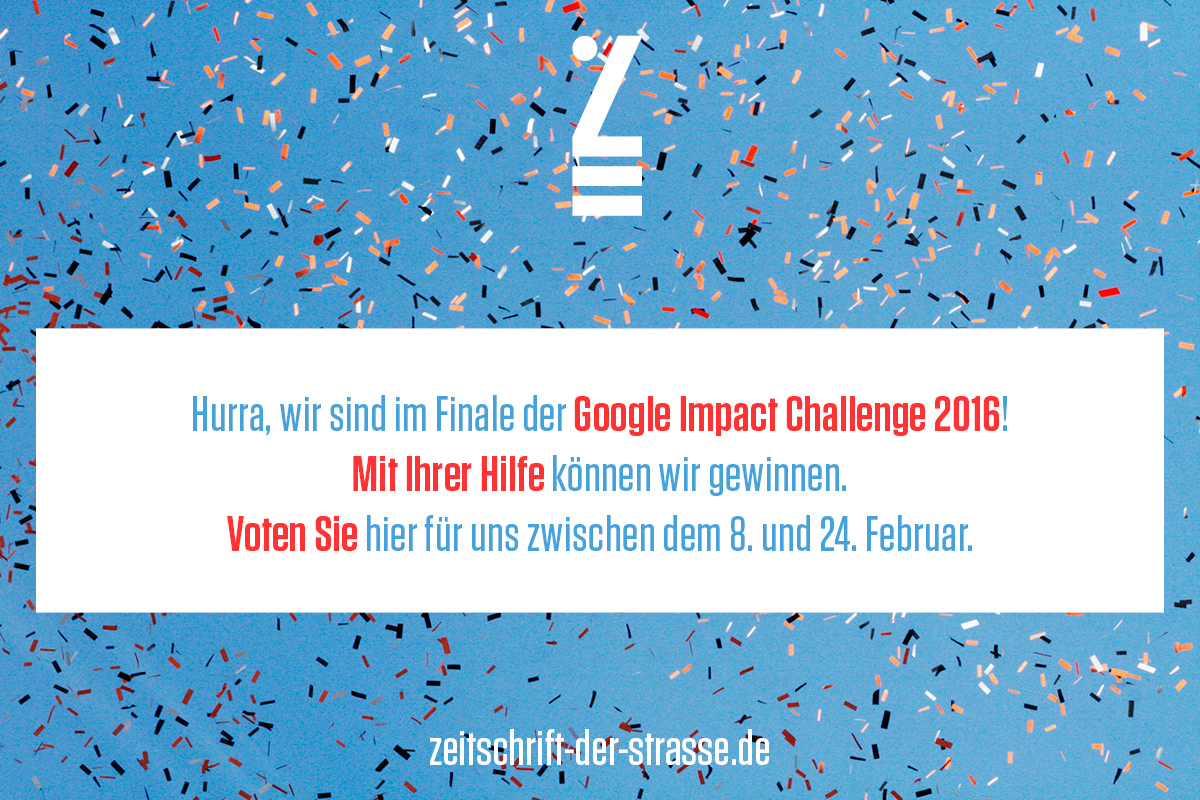SURPRISE / Schweiz: Als René Mocellin, 64, nach jahrelanger Schreibarbeit seine Autobiografie beendet hatte, wurde ihm langweilig. Seit bald einem Jahr verkauft er deshalb Surprise am Bahnhof Basel SBB.
„Ich muss zugeben, dass ich anfangs Hemmungen hatte, das Strassenmagazin zu verkaufen. Ich befürchtete, dass man mich als randständig wahrnehmen würde, und dieses Image will ich auf keinen Fall. Dann sagte ich mir: Ich mach das einfach auf meine Art. Ich sehe nicht verwahrlost aus, und meine Ausrüstung mit dem Bildschirm und den anderen Extras erweckt auch nicht den Anschein.
Jetzt bin ich fast ein Jahr bei Surprise dabei, seit März 2015. Ich verkaufe fast jeden Tag von zehn Uhr morgens bis in den Abend hinein am Haupteingang des Basler SBB-Bahnhofs. Und ich muss sagen: Mir gefällt die Aufgabe. Ich bekomme nette Rückmeldungen von den Leuten, meine Elektronik gefällt ihnen. Ich habe immer Leuchttafeln dabei, die ich selber installiere. In der Adventszeit nahm ich einen kleinen leuchtenden Tannenbaum mit, das kam besonders gut an. Einmal ging eine jüdisch-orthodoxe Familie an mir vorbei, und die Kinder machten ganz grosse Augen, als sie den Baum sahen. Da sagte ich laut: ‚Chanukka!‘, und alle mussten lachen.
Meine Autobiografie – Ein Einblick in den Schreibprozess
Mit Details zu meiner Lebensgeschichte möchte ich mich derzeit eher zurückhalten. Nicht, weil ich etwas zu verstecken hätte, im Gegenteil: Ich stehe kurz vor dem Abschluss der Arbeit an meiner Autobiografie. Ich hoffe, dass ich in den kommenden Monaten einen Verlag dafür finde und das Ganze als Buch veröffentlichen kann. Bis dahin möchte ich natürlich nicht schon alles verraten. Geschrieben habe ich das Buch über die letzten Jahre hinweg. Derzeit bin ich vor allem damit beschäftigt, den Text zu überarbeiten. Dazu habe ich meine eigene Methode: Ich spreche die Geschichte auf Band, alles an einem Stück. Für die 360 Seiten brauche ich rund zwölf Stunden. Früher habe ich dazu noch ein Revox G36-Tonbandgerät verwendet, mittlerweile mache ich es mit Aufnahmegerät mit Chipspeicherkarte.
Nach der Aufnahme höre ich sie mir an und mache stilistische Verbesserungen. Dieses Prozedere habe ich jetzt schon zehn bis 15 Mal gemacht, mittlerweile kann ich ganze Passagen auswendig. Es ist eine sehr intensive Konfrontation mit meinem eigenen Leben. Manchmal macht es mich auch traurig. In einer Szene beschreibe ich, wie ich mit meiner mittlerweile verstorbenen Mutter im Quartierrestaurant etwas Kleines essen gehe. Ich erinnere mich noch genau, wie ich zum Wurlitzer ging und ein paar alte Schlager wählte. Und auf Wunsch meiner Mutter ‚Lara’s Lied‘, die Titelmelodie von Dr. Schiwago. Ich sehe, wie sie mir gegenüber am Tisch sitzt und höre innerlich das Lied. Die Situation wird wieder lebendig, und das macht mich sentimental.
Hoffnung auf eine bessere Zukunft
Als das Buch zum grössten Teil fertig geschrieben war, hatte ich als IV-Rentner plötzlich viel freie Zeit. Und mir wurde, ehrlich gesagt, etwas langweilig. Ich dachte mir: Du musst etwas tun, damit du unter die Leute kommst. Am Claraplatz hatte ich schon ab und zu Surprise-Verkäufer gesehen. Und so bin ich dann zum Strassenmagazin gekommen. Es setzt mir zu, wenn ich von frühmorgens bis am Abend draussen stehe, das fällt mir schwer. Zudem muss ich, wenn ich einigermassen gut verkaufe, zwei Drittel meines Verdienstes abgeben, so sind die Regeln der IV.
Aber es ist die Mühe allemal wert. Ich habe sozialen Kontakt und kann am Ende trotz allem ein klein wenig Geld auf die Seite legen. Wenn ich mir Mühe gebe und zum Beispiel konsequent in Deutschland einkaufe, dann komme ich alles in allem gut durch. Für grosse Sprünge reicht es natürlich nicht, Ausflüge liegen nicht drin. Ich würde gerne mal verreisen, nach Köln, Amsterdam oder Berlin. Ich hoffe, dass das mit den Einnahmen aus meiner Biografie dann geht.
Meine Erfahrungen mit Straßenverkäufen in den Siebzigern
Ich habe übrigens Anfang der Siebzigerjahre schon einmal etwas Ähnliches gemacht wie Surprise: Nach der Scheidung meiner Eltern steckte mich die Vormundschaftsbehörde 1962 für sechs Jahre ins Erziehungsheim. Als ich da endlich rauskam, ging ich ins Elsass. Dort schlug ich mich erst als Küchenhilfe durch, schrubbte Pfannen und Geschirr. Ein grosser Teil des Lohns ging für das schäbige Zimmer drauf, das mir der Besitzer vermietete. Also suchte ich etwas anderes und landete bei einem Magazin, das zugunsten behinderter Kinder verkauft wurde. Wir fuhren zu viert mit dem Auto durch die Dörfer und verkauften die Hefte. Die Hälfte des Verkaufspreises durften wir behalten, wie bei Surprise. Das war sehr unterhaltsam. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie sich im Leben Kreise schliessen.“
Text und Bild: mit freundlicher Genehmigung von INSP.ngo / Surprise