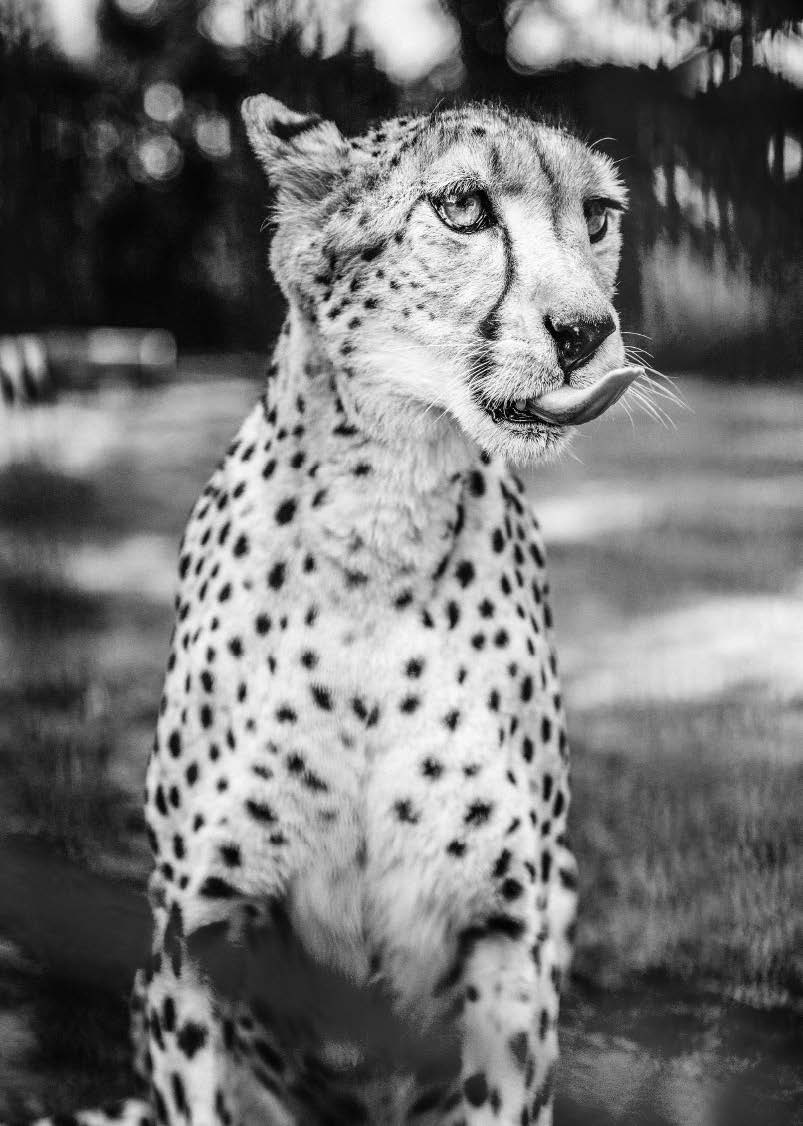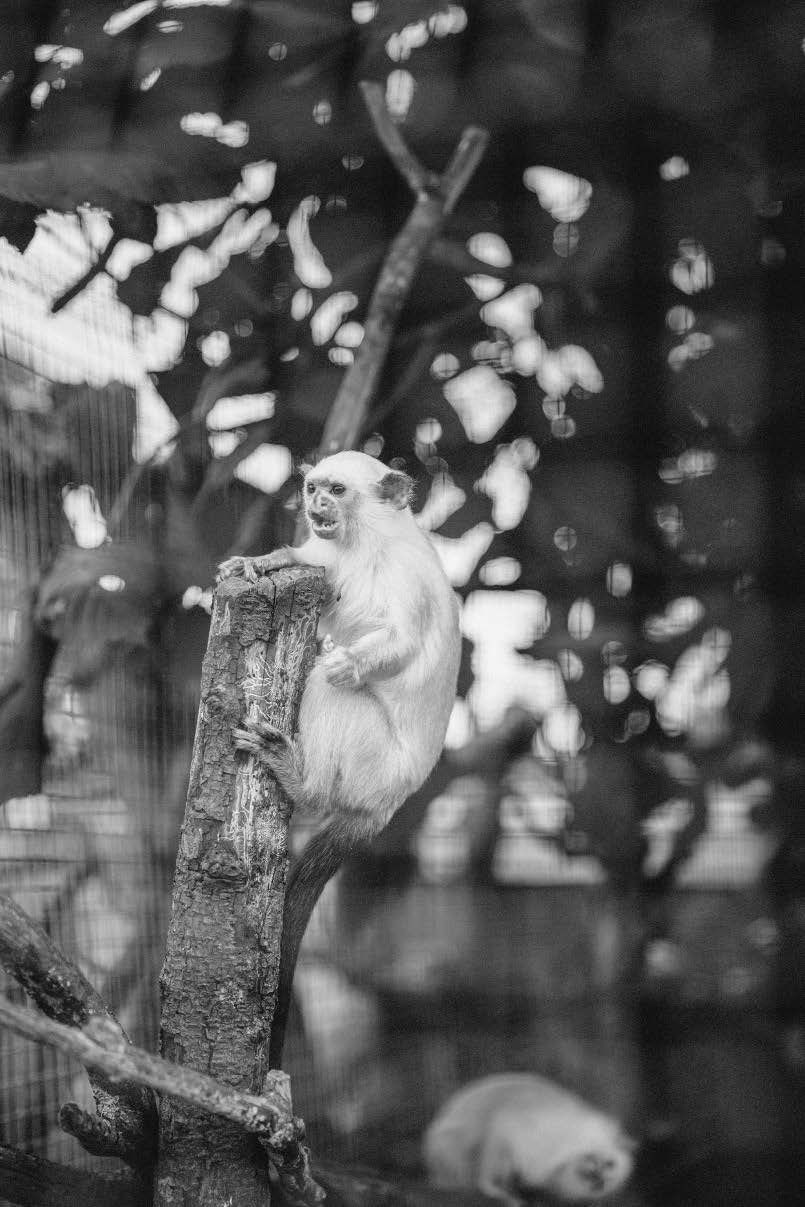#94 BISMARCKSTRASSE – Ein bisschen verwunschen wirkt er ja schon: der Edelsteinladen Kassiopeia. Dabei ging es hier anfangs nur um das Geschäft mit Kaffee aus aussortierten Bohnen
Der Name „Kassiopeia“ lässt zunächst an Sternbilder und Mythologie denken. Auch der kleine Laden an der Bismarckstraße hat auf den ersten Blick etwas Magisches an sich, mit seinen dezenten, aber kunstvollen Verzierungen und seiner schweren Holztür. Dabei ging es bei der Gründung 1952 zunächst vor allem um Kaffee, erst später kamen Schmuck und Edelsteine dazu.
Begonnen hat die Geschichte in der zwei Kilometer entfernten Weberstraße. Dort gründeten Josef und Ursula John ihre Firma. Auch der Name hatte für Josef John nicht viel mit Magie oder Mystik zu tun. Er war U-Boot-Fahrer im Krieg und hat oft in den nächtlichen Sternenhimmel geblickt. Dabei hat er besonderes Gefallen an dem Sternbild der Kassiopeia gefunden und sich schließlich entschieden, seine Firma nach ihm zu benennen. Auch in der Einrichtung des kleinen Geschäftes lassen sich die maritimen Einflüsse wiederfinden. Der vom Licht der Vitrinen ausgeleuchtete Verkaufsraum ist gefüllt mit solchen Andenken: die Schiffsglocke etwa oder eine Galionsfigur. Gemütlich ist es. Und die heimelige Atmosphäre macht Lust, es sich beim Tee auf dem Sofa bequem zu machen.
Nach Kriegsende vor 70 Jahren hat das Ehepaar John vor allem Kaffee verkauft. Der war damals sehr gefragt, erzählt Ursula John. Allein in Bremen habe es über 400 Kaffeeversandhäuser gegeben und die beiden stiegen ein in das aufblühende Geschäft: „Die Menschen sind ja hinter jeder Kaffeebohne hergerannt.“ Angefangen haben sie mit sogenanntem Verlesekaffee. „Bohnen, die nicht so schön aussahen, hat man ja damals rausgenommen aus dem Kaffee“, berichtet Ursula John. Mit ihrem Mann hat sie diese Kaffeebohnen gezielt aufgekauft.

Der Umzug aus der Weberstraße stand gleich nach zwei Jahren an. Das hatte mit der Hochzeit von Josef und Ursula John zu tun. „Früher war es ja so, dass man nicht zusammenleben durfte, wenn man nicht verheiratet war“, erzählt sie. „Selbst als diese Wohnung hier gemietet wurde, haben alle Menschen darauf geachtet, dass wir ja nicht zusammen hier übernachten.“
Zum Kaffee wurden nach und nach immer mehr Produkte in das Sortiment aufgenommen und mittlerweile hat sich der Schwerpunkt auf Tee verschiedenster Sorten verlagert. Man findet schwarzen Tee, Rooibos oder auch grüne Tees. Ins Auge springt allerdings etwas völlig anderes: Die Vitrinen im vorderen Teil des Ladens sind gefüllt mit Edelsteinen, Schmuck und Perlen. „In unseren Anfangsjahren wurden wir nach Perlen gefragt. So etwas gab es nach dem Krieg alles gar nicht“, sagt Ursula John, „und wir haben dann rumgehorcht und unsere ersten aus Japan importiert.“ Später kamen die Edelsteine dazu. „Dann wollten die Leute Jadeketten haben, dann andere und so ist das immer mehr geworden mit den Edelsteinen.“
Die Johns haben sich umgehört und immer neue Quellen aufgetan. Das habe sich eben so ergeben, über Kontakte zu Menschen, „die drüben gewesen sind und Steine mitgebracht haben.“ Schließlich kamen sie auf Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz, einen zentralen Umschlagplatz für Edelsteine aus aller Welt.
Und da kommt auch die Esoterik wieder ins Spiel. Denn auch wenn die Johns selbst nicht an die magischen Kräfte von Edelsteinen glaubten, legten sie doch Flyer aus, auf denen die übernatürlichen Bedeutungen der Steine beschrieben wird: ihre Auswirkungen auf das Gefühlsleben, mutmaßliche Heilkräfte und die Zusammenhänge einzelner Steine mit den Tierkreiszeichen.

Mit dem Infomaterial kamen die Johns dem Interesse ihrer Kundschaft entgegen. Die erzählten beim Einkauf, dieser Stein hier sei für dieses gut, der da für jenes, „… und da haben wir uns Bücher gekauft, haben das Wissen den Kunden zur Verfügung gestellt.“ Ursula John kommentiert das mit einem Lächeln: „Wir haben immer gesagt, ein Stein tut gut, wenn er dir auch gefällt. Edelsteine sind eben etwas Besonderes.“
Mit Vorurteilen oder Ein- wänden gegenüber Tierkreiszeichen und übernatürlichen Heilkräften von Edelsteinen wurde Ursula John in der gesamten Zeit, die Kassiopeia nun besteht, noch nie konfrontiert. „Wenn jemand das nicht glaubt, interessiert er sich gar nicht dafür. Dann kommen die auch nicht zu uns“, erzählt sie lapidar.
„Die Kunden finden die Steine schön und sagen: Wenn die mir dann guttun, ist das ja eine schöne Sache.“ Ursula John betont allerdings auch, dass sie nie etwas in esoterischer Richtung aktiv angestoßen habe. „Wir wollten keinen Aberglauben fördern. Wir fanden die Steine auch schön. Es hat uns Spaß gemacht, damit zu arbeiten.“ Freude macht ihr auch der Austausch mit den interessierten Kunden, „die oft auch viel mehr davon wussten als wir“.
Und ein bisschen steckt das an, wenn man im Gespräch mit der sympathischen Dame ihr ungewöhnliches Geschäft kennenlernt. Zumindest für den Blick auf diese besondere Sparte Einzelhandel gilt: Die Bismarckstraße hat durchaus ihre bezaubernden Seiten.
| Text und Recherche: Lara Nagel, Eileen Stoffers, Katharina Witkabel | Fotos: Beate C. Köhler |