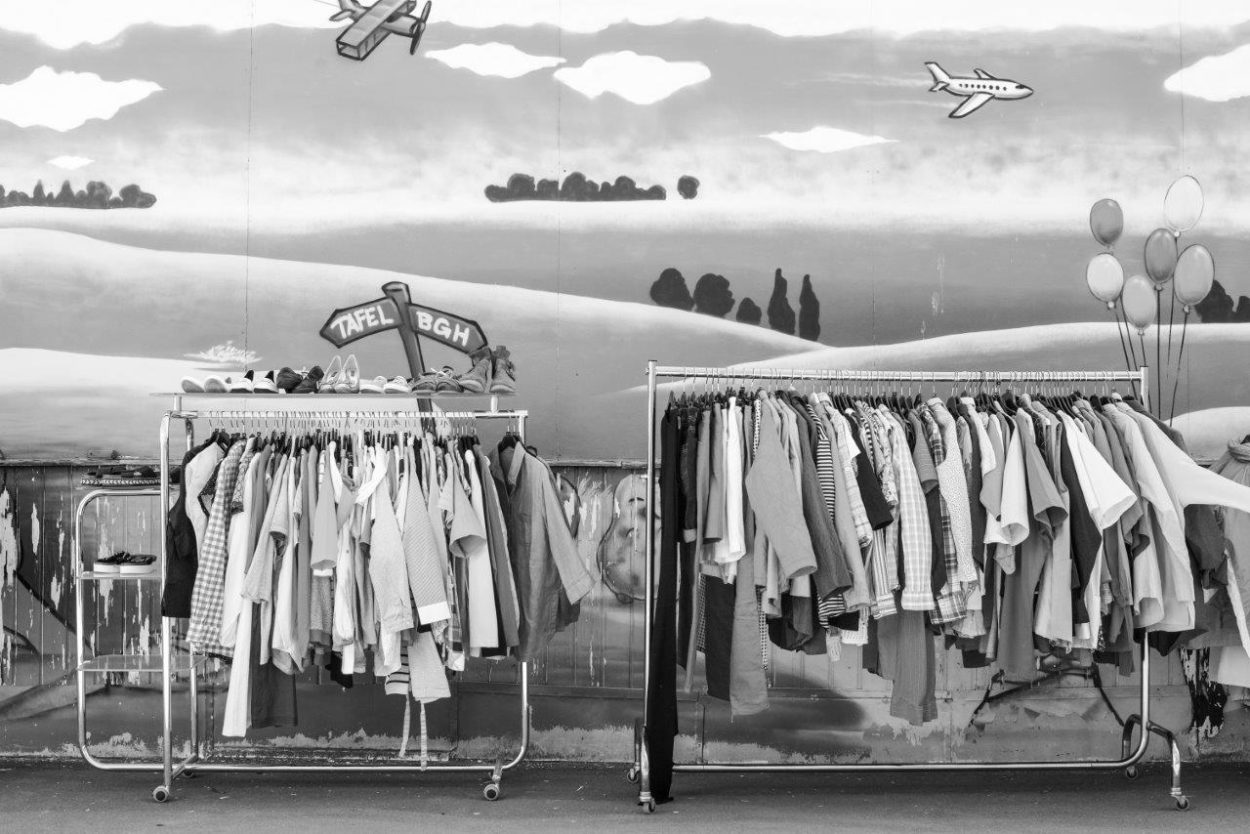#81 DIE LESUM – Auf der „Schulschiff Deutschland“ lernten Generationen von Seemännern ihr Handwerk. Ein Blick zurück
Weiß glänzend liegt an der Lesum in Vegesack ein besonders Schiff. Es ist die „Schulschiff Deutschland“, denn in der Sprache der Schifffahrt sind Schiffe weiblich. Über Jahrzehnte wurden auf dem Dreimaster Matrosen und Offiziere ausgebildet. Er ist das einzige noch erhaltene Vollschiff und Segelschulschiff der deutschen Handelsschifffahrt.
„Vegesack ist ein sehr wichtiger historischer Ort für die maritime Geschichte Bremens“, erklärt Claus Jäger, Vorsitzender des Deutschen Schulschiff- Vereins, der das historische Schiff als Denkmal erhält. So ist der Vegesacker Hafen von 1623 der erste künstliche deutsche Hafen überhaupt. Jägers Büro liegt direkt am Wasser, neben der „Schulschiff Deutschland“, das 1927 vom Stapel lief. Der Kapitänssohn hat freien Blick auf sie.
86 Meter ist der Rahsegler lang, die drei Masten etwa 50 Meter hoch. Die Schiffswände sind aus Stahl geschmiedet. Wer die „Schulschiff Deutschland“ heute besichtigt und einen Blick auf die dunklen Holzwände des Kapitäns-Salons wirft oder die beeindruckende Takelage emporblickt, kann kaum erahnen, wie das Leben der jungen Männer war, die früher für zwei Jahre ihre Ausbildung auf diesen Planken erhielten.
Schiffsjungen, Schwindelprüfungen und die strenge Seemannsordnung
Einschließlich des Kapitäns befanden sich damals bis zu 170 Mann an Bord, im wahrsten Sinne des Wortes. „Dass Frauen auf die Idee gekommen wären, zur See zu fahren, das gab es eigentlich nicht“, sagt Jäger. „Ich weiß nicht, ob jemand es versucht hat, doch die Frage stellte sich auch nicht, wenn man sich die Satzung unseres Vereins aus dem Jahre 1900 ansieht: ‚um junge Männer zu Seeleuten zu erziehen‘, heißt es da.“
Wer auf dem Schulschiff ausgebildet werden wollte, musste fit sein, gute Augen haben – und schwindelfrei sein. Das wurde unter anderem mit der Schwindelprüfung getestet: Die Zöglinge, wie man sie nannte, mussten den Mast hochklettern. Nach der Aufnahme mussten sie einen Ausbildungszuschuss berappen – das sogenannte „Pensionsgeld“. Hatte man die Aufnahmeprozedur erfolgreich bestanden, war man „angemustert als Schiffsjunge“. Dies wurde in einem persönlichen Seefahrtbuch vermerkt. Von nun an mussten sich die Zöglinge an die Seemannsordnung halten.

Das spartanische Leben an Bord eines Rahsegler
Das Leben an Bord war sehr spartanisch. „Das Mittelschiff war ein großer Raum“, erklärt Jäger. „Da schliefen, arbeiteten und aßen 80 Leute. Jeder hatte seine Hängematte an der Decke hängen, die wurde dann eingerollt während des Tages.“ An hochklappbaren Tischen wurde gearbeitet und gegessen. Erst in den 1950er-Jahren wurden die ersten Kabinen geschaffen.
Mittlerweile haben es die Gäste des Schiffs komfortabler. Für 70 Euro inklusive Frühstück kann man in einer Zweierkajüte übernachten. Sobald die enge Treppe unter Deck bezwungen ist, führt ein schmaler Gang zu den Außenkammern – kleine Zimmer, mit zwei Kojen übereinander. Es ist kaum Platz für den Tisch und die zwei Stühle, aber durch ein Bullauge ist das Wasser zu sehen.
Für die „Zöglinge“ der Zwanziger- und Dreißiger-Jahre war Privatsphäre kaum vorhanden. Die Arbeit war hart, die See oft rau. Die meisten litten daher am Anfang unter schlimmer Seekrankheit, erzählt Jäger. Nach einigen Tagen würden die meisten Menschen jedoch immun dagegen. Für die Zöglinge war das entscheidend: Zur Ausbildung gehörten je zwei ausgedehnte Sommer- und Winterfahrten auf dem Rahsegler. „Die Winterreisen gingen in den Süden, denn südlich des Äquators war ja dann Sommer, und die Sommerreisen waren in Nord- und Ostsee“, sagt Jäger.
Vom Ausbildungsort zur Ruheoase
Am Ende ihrer Ausbildung sollten die Zöglinge alle Aufgaben an Bord übernehmen können – unabhängig von Wind, Wetter und Wellengang. „Dieses Zusammenwirken in der Gemeinschaft, sich auf den anderen verlassen und besondere Herausforderungen bewältigen zu können, das ist nach Auffassung der maßgeblichen Leute bei der Marine das Entscheidende“, sagt Jäger. „Das ist eine Persönlichkeitsprägung und eine Ausbildung von Fähigkeiten, die man sonst nicht kriegt.“
Die „Schulschiff Deutschland“ wurde nie als Kriegsschiff geführt, sondern immer als Teil der Handelsmarine. Insgesamt legte sie unter vier Kapitänen bei zwölf Überseereisen und 17 Ausbildungsfahrten in Nord- und Ostsee eine Strecke zurück, die siebeneinhalb Mal dem Erdumfang entspricht. Sie ankerte vor Buenos Aires, den Bahamas und Venezuela, bevor sie 1939 ihre letzte weite Reise beendete. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges diente das Schulschiff für kurze Zeit als Lazarettschiff. So konnte sie vor einer Auslieferung an die Briten geschützt werden.
Die ‚Schulschiff Deutschland‘
1952 fand die „Schulschiff Deutschland“ in Woltmershausen einen Heimathafen, wo sie 20 Jahre lang als stationäre Seemannsschule diente. 1972 wurde sie umgebaut und als Ausbildungsinternat und Werkstatt genutzt. Seit 1996 liegt das Schulschiff am jetzigen Liegeplatz in Vegesack, an der Lesum-Mündung – zuletzt beherbergte sie Schiffsmechaniker. 2001 stellte die Berufsschule für angehende Seeleute ihren Ausbildungsbetrieb ein.
Seitdem geht es an Bord der „Schulschiff Deutschland ruhiger zu. Beherbergt sie keine Übernachtungs- oder Hochzeitsgäste, ist das letzte Vollschiff Deutschlands einfach im Ruhestand.
| Text: Chiara Purnhagen | Fotos: Felix Müller |