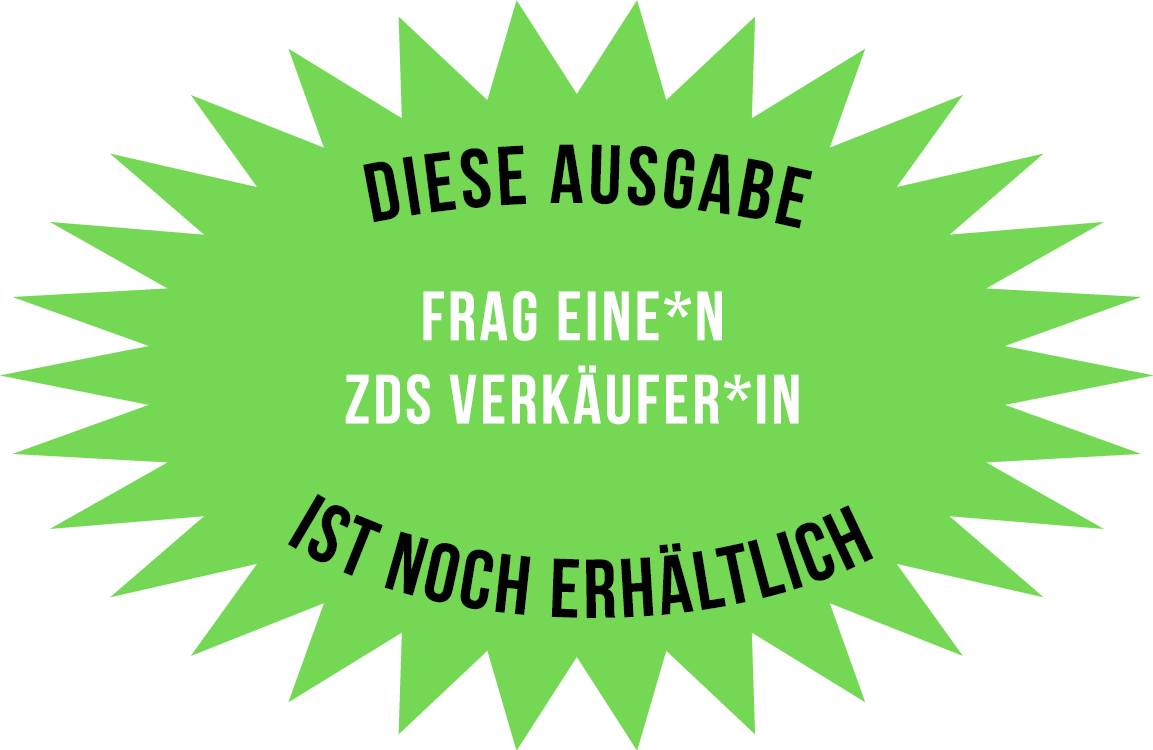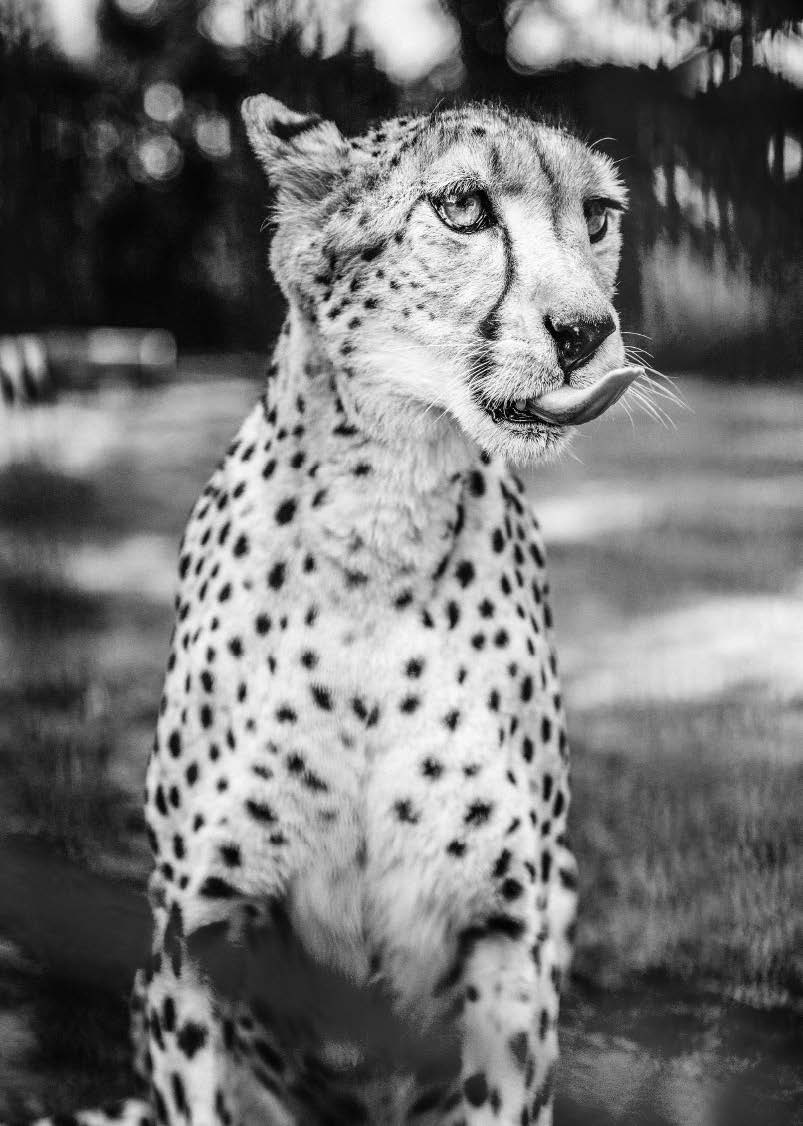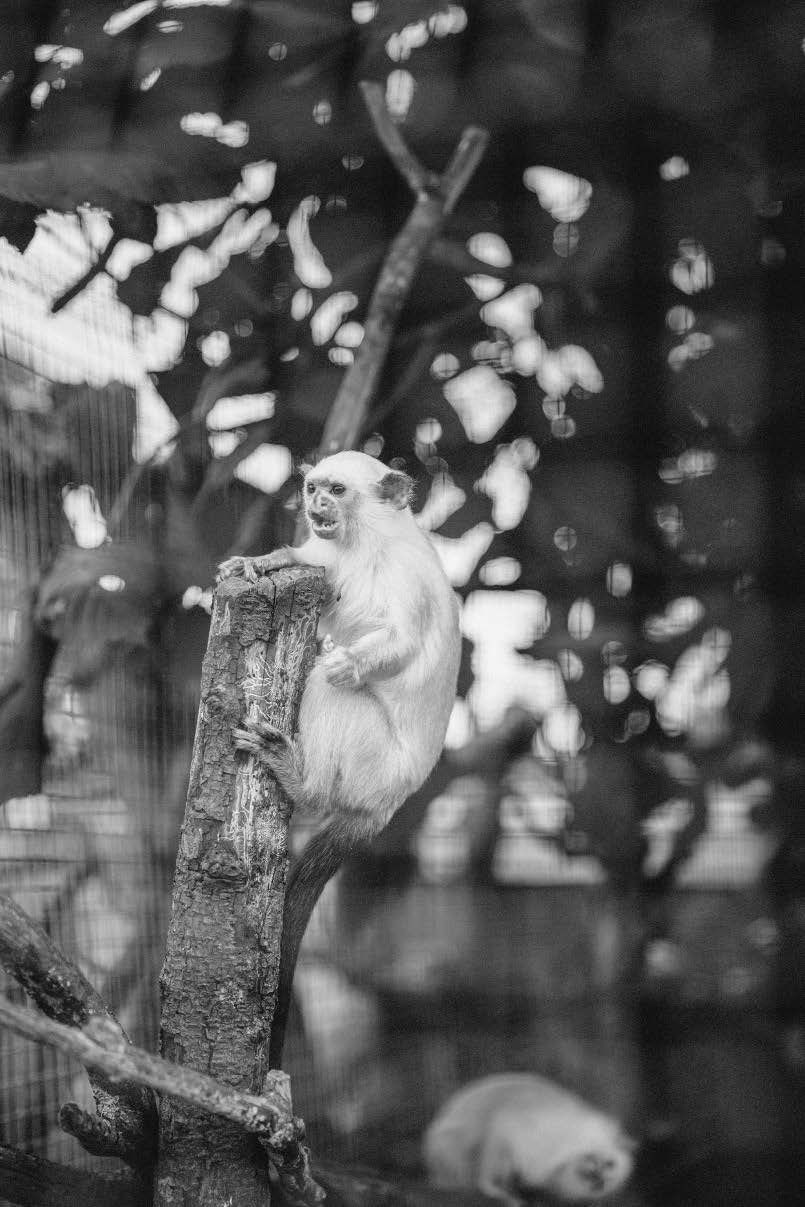#91 HEMELINGER BAHNHOFSTRASSE – Der mit Abstand meiste Verkehr um die Hemelinger Bahnhofstraße ist an der Oberfläche gar nicht zu sehen. Er wird seit Jahren untendurch geleitet
Wenn man etwas hören oder fühlen könnte, dann müsste es an dieser Stelle sein: exakt unter der Bushaltestelle „Hemelinger Bahnhofstraße“ an der Nordwestecke des kleinen Wilkensparks. Hier kreuzt unterirdisch der Hemelinger Straßentunnel. Aber weder vibriert es unter den Füßen, noch hört man leisestes Rauschen. Ganz anders vor der Tunnelöffnung an der Sebaldsbrücker Heerstraße: Die frühere Belastung der Straßen lässt sich hier erahnen. Welch ein immenses Autoaufkommen ergießt sich tagtäglich hinein und wälzt hinaus! Lkw verschiedenen Kalibers rattern, Pkw fahren zügig um die Kurven, oben kreuzt die Straßenbahn. An der Fußgängerampel vor der Tunnelöffnung ist eine Verständigung im Lärm kaum möglich. Im Auto jedoch ist es ein angenehmeres Erlebnis. Der mit knapp 600 Metern längste Straßentunnel Bremens leitet Kraftfahrzeuge unter zwei Eisenbahntrassen und der ganzen Godehardstraße durch. Radfahrer und Fußgänger können abgetrennt neben der Fahrbahn die Bahntrassen unterfahren – begleitet von Lärm, aber sicher.
Es ist schon klar, warum in Hemelingen viele bereits in den Siebzigerjahren ohne Tunnel den Schwerlast- und Durchgangsverkehr satt hatten. Durch die Großansiedlung von Mercedes-Benz 1978 in Sebaldsbrück mit zunächst rund 6.000 Beschäftigten verschärfte sich die Lage. Erwartet wurden täglich 16.000 Fahrzeuge auf dem Weg ins Werk und hinaus, darunter 8.000 Lkw Die neuen Anforderungen waren enorm. Vor allem Brügge weg, Schlengstraße und Bruchweg waren durch Lärm, Abgase und Staus extrem belastet. Auch die Hemelinger Bahnhofstraße blieb nicht verschont. Frau Riedemann-Schmitz vom traditionsreichen Schuhgeschäft erinnert sich: „Beim Daimler-Schichtwechsel abends um zehn war der Brüggeweg voll und die Autos wälzten sich Stoßstange an Stoßstange da durch. Wenn der Brüggeweg dann dicht war, sind alle hier durchgefahren. Manche Bewohner sind auch weggezogen, weil sie es mit der Verkehrsentwicklung nicht mehr aushielten.“
Um 1988 kam die Tunnel-Idee in Gang, wurde aber Mitte der Neunziger wegen hanseatischer Sparsamkeit in schwieriger Haushaltslage wieder ausgebremst. Ein mehrfach zitierter Satz des damaligen Ortsamtsleiters beleuchtet die Stimmung: „Eine Verarschung aller Hemelinger ist das.“ Heftige Debatten über die Sanierung Hemelingens fanden in diesen Zeiten statt . Erst 1999 begann der Tunnelbau. 2003 wurde die unterirdische Straße zum Preis von rund 175 Millionen Euro eingeweiht. Eine Filmdokumentation der damals für den Bau verantwortlichen Gesellschaft für Projektmanagement und Verkehrswegebau verdeutlicht den Aufwand, etwa die Arbeiten unter dem Grundwasserspiegel, die unter Druckluft statt fanden. Heute kaum denkbar: Alles entstand in der vorgesehenen Bauzeit.
Verlustfrei ging das nicht vonstatten. So mussten vor dem Bau Wohnhäuser „abgeräumt“ werden, wie es in einem Beiratsprotokoll von 1997 heißt. „In der Godehardstraße waren es acht oder neun, in unserer Straße zwei“, so Frau Riedemann-Schmitz. „Dazu gehörte auch der Wilkens-Bungalow, der auf dem Villengrundstück für einen der Söhne gebaut worden war.“ Diese Vorgänge waren zwar rechtens, aber mit Schicksalen verbunden. Die Entschädigung dürfte für eine neunzigjährige Frau, die ihr Haus am Lebensende verlassen musste, kein Trost gewesen sein.
In der Hemelinger Bahnhofstraße zeigt Frau Zaun von der Firma Seekamp Metall rüber zum anliegenden Parkplatz: Diese Fläche musste der Betrieb für den Tunnelbau hergeben. Und bis heute teilen Beschäftigte und Firmenleitung dort das Innenleben der angrenzenden Röhrenöffnung, denn „gelegentlich riecht es daraus. Und oft hören wir die lauten Krankenwagensirenen“, beschreibt Frau Zaun die Lage. Die Röhre ist hier ein akustischer Verstärker.
Unbestreitbar ist aber die deutliche Entlastung des Durchgangsverkehrs. Bereits kurz nach Eröffnung 2003 nutzten durchschnittlich 12.422 Fahrzeuge den Tunnel t.glich. Stefan Last, Projektingenieur beim Amt für Straßen und Verkehr, erklärt: „Heute sind es rund 20.000 Fahrzeuge, davon 14 Prozent Lkw.“ Last spricht über Folgekosten: „Für den Unterhalt reicht eine Viertel Million pro Jahr nicht.“ Wofür? Allein die Stromkosten belaufen sich jährlich auf 100.000 Euro. Er ergänzt Wartungs- und Sicherheitsmaßnahmen, dazu einige Beispiele: Für frühzeitiges Erkennen von Problemen im Tunnel kontrolliert die Polizei 17 Kameras rund um die Uhr. Sichttrübung und CO2-Werte werden gemessen, Strahlventilatoren sorgen für Frischluft zufuhr, aufwendige Feuerwehrübungen finden alle sechs Jahre nächtlich bei Vollsperrung statt . Mit hohem Sicherheitsstandard werden die anspruchsvollen EU-Anforderungen an einen Tunnelbetrieb erfüllt.
Bedeutsam für Planung und Folgen des Tunnelbaus waren noch andere wichtige Bewegungen. Im Stadtteil mobilisierten sich damals Kräfte, die sich für die Lebensqualität über der Trasse starkmachten, besonders für eine anwohnerfreundliche und grüne Gestaltung. Unter anderem wurde vor Baubeginn durchgesetzt, dass in der Hemelinger Bahnhofstraße die Wilkens-Villa und der Park mit dem alten Baumbestand nicht, wie es der Plan vorsah, der Untertunnelung geopfert wurden. „Es handelt sich dabei um sehr alte, kapitale Blume, deren Erhalt von hervorragender Bedeutung ist“, schrieb Ortsamtsleiter Rissland 1996 nach einer einstimmigen Beiratsentscheidung an Bausenator Hattig. Eine Verlegung der Tunnelachse unter die Godehardstraße wurde erreicht. Heute ist das Ensemble ein optischer Glücksmoment der Straße.
| Text: Ulrike Plappert | Foto: Volker Busch |